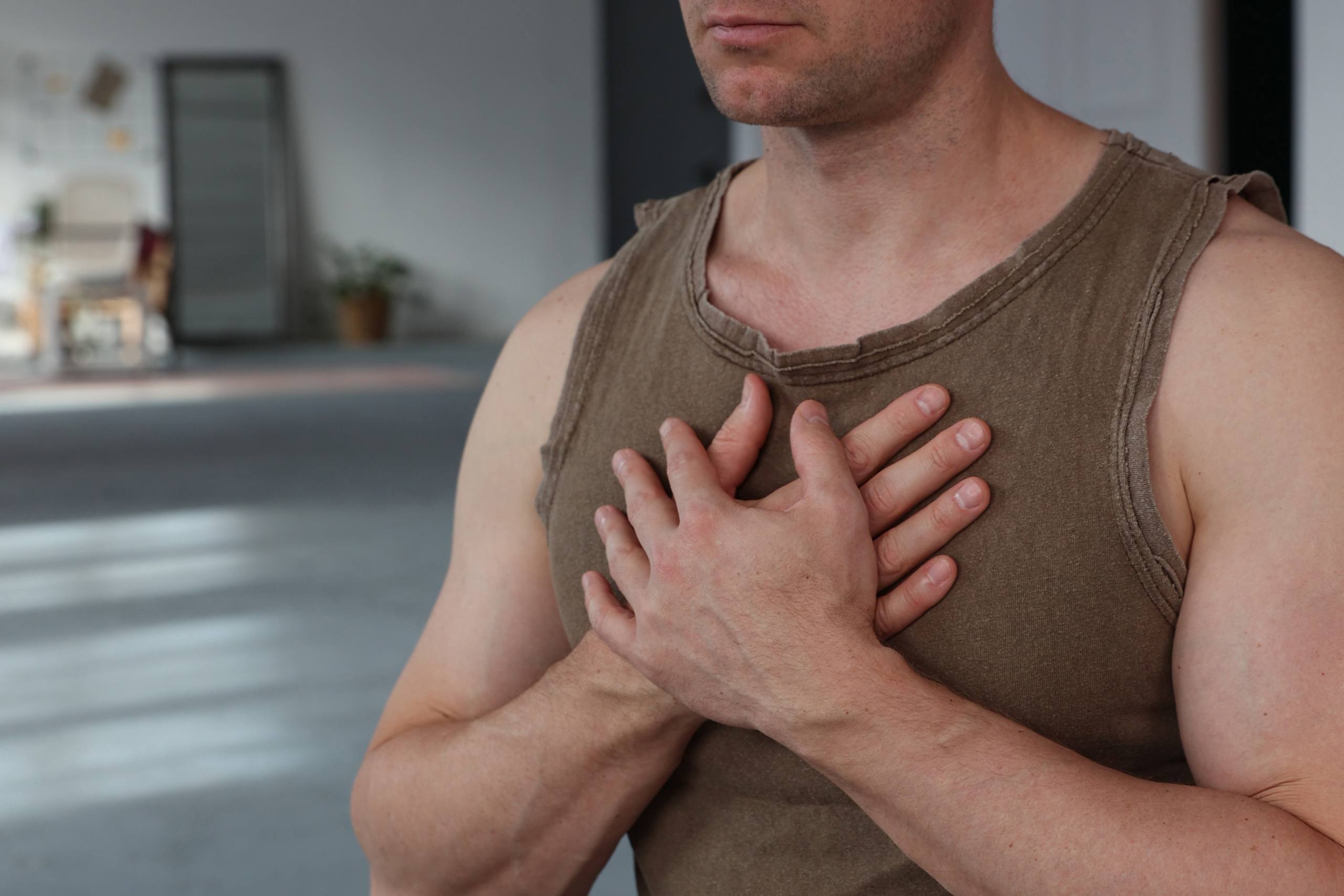Wer spricht (oder schreibt) schon gerne über Demenz – erst recht, wenn man den geistigen…

Auch Männer haben Ängste … und Angststörungen
Manche Phobien bringen uns zum Schmunzeln. Aelurophobie zum Beispiel ist die Angst vor kleinen Kätzchen, Novercaphobiker fürchten sich vor Schwiegermüttern und als Genuphobie wird die Angst vor Knien bezeichnet. Doch für die Betroffenen sind ihre Phobien nicht witzig. Insgesamt gibt es in der Psychologie mehrere hundert Angststörungen und entsprechende Fachbegriffe. Ein guter Grund, diesem Thema einen Blogbeitrag zu widmen und dabei wichtige Fragen zu beantworten: Was ist eigentlich Angst und wie entsteht sie? Wann wird aus Angst eine Angststörung? Und welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
Warum haben wir Angst?
Angst kann durchaus nützlich sein. Evolutionsgeschichtlich gesehen ist sie ein Schutz- und Überlebensmechanismus, der in Gefahrensituationen eine Reaktion – Kampf oder Flucht – einleitet. Sie schärft die Sinne und aktiviert die Körperkraft, jedoch nur in der richtigen Dosierung. Zu viel Angst wirkt lähmend, zu wenig Angst lässt Menschen reale Gefahren nicht erkennen.
Um die Kampf- bzw. Fluchtfähigkeit zu stärken, ist Angst auch mit körperlichen Symptomen verbunden: Mit erhöhter Herz- und Atemfrequenz sowie steigendem Blutdruck wird den Muskeln mehr Energie zur Verfügung gestellt. Auch Seh- und Hörnerven arbeiten auf Hochtouren, während etwa Verdauungstätigkeiten gehemmt werden. Der volle Fokus von Körper und Geist richtet sich auf die Bedrohung und ihre Abwehr.
Alle beschriebenen Phänomene sind normal. Ältere medizinische und psychologische Annäherungen, die Angst von vornherein als krankhaft darstellen, werden heute daher kaum noch vertreten. Es ist sogar üblich, dass sich Menschen absichtlich Ängsten aussetzen, um einen „Kick“ zu erleben, also den Übergang von der Anspannung zur Erleichterung. Beispiele sind Extremsport, aber auch ein aufregender Horrorfilm im Kino.
Wenn Angst zur Krankheit wird …
Was die Frage aufwirft: Wann wird aus Angst eine Angststörung? Dafür gibt es mehrere Anhaltspunkte:
- Die gefühlten Gefahrensituationen sind objektiv nicht gefährlich (z. B. das kleine Kätzchen).
- Ängste kommen und gehen – Angststörungen dagegen bleiben, werden zu ständigen Begleitern im Alltag und beeinträchtigen die Lebensqualität.
- Bei Angststörungen sind die Ängste übersteigert, auch in Bezug auf die körperlichen Reaktionen. Aus einer höheren Herzfrequenz wird Herzrasen, die intensivierte Atmung mündet in Atemnot und ein stark erhöhter Blutdruck führt zu Schwindelgefühlen.
Phobien beziehen sich auf einen bestimmten Auslöser. Manchmal können Angststörungen aber auch unspezifisch und schubweise auftreten. Die Medizin spricht in diesen Fällen von einer Panikstörung oder der generalisierten Angststörung.
Wie entstehen Angststörungen?
Mit der Vielzahl der Erscheinungsformen geht eine Vielzahl von möglichen Gründen für Angststörungen einher. Eine genetische Veranlagung zählt ebenso dazu wie traumatische Erfahrungen, belastende Lebensereignisse (beruflicher Stress, Trennung, finanzielle Schwierigkeiten usw.) oder eine ungünstige kindliche Entwicklung durch über- oder unterfürsorgliche Eltern.
Angststörungen zählen neben Depressionen und Burnout zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Exakte Fallzahlen sind in Österreich nicht bekannt, doch Schätzungen zufolge leiden 16 Prozent der Gesamtbevölkerung an behandlungsbedürftigen Angststörungen. Auf dem Papier sind Frauen häufiger betroffen als Männer – doch die Dunkelziffer von betroffenen Personen, die sich nicht in Behandlung begeben, dürfte diesen Unterschied zumindest teilweise ausgleichen.
Männer meiden Ärzte (auch das ist übrigens eine Phobie). „Selbst ist der Mann“, heißt es oder: „Was mich nicht umbringt, macht mich stärker.“ Diese Einstellung ist bei vielen Erkrankungen gefährlich, auch bei Angststörungen. Denn die natürliche Reaktion auf Ängste ist, die Angstsituationen zu vermeiden. Bei übersteigerten Ängsten kann es allerdings leicht passieren, dass man sich abkapselt, soziale Kontakte verliert und sich seiner Angst voll und ganz ergibt.
Therapie von Angststörungen
Die Alternative? Das Wichtigste ist wohl, dass man ehrlich zu sich selbst ist … und ehrlich zu anderen. Beim Helden.Check, einer jährlichen kostenlosen Vorsorgeuntersuchung, wird mit einem Fragebogen neben dem körperlichen auch das psychische Wohlbefinden erhoben. Bei Angststörungen kann dieser Befund der erste Schritt zu einem besseren Leben sein.
Wie bei vielen psychischen Erkrankungen hat sich auch bei Phobien und Co. eine Mischung aus psychotherapeutischen und medikamentösen Maßnahmen bewährt. Bereits die Psychoedukation, also das Aufklären über Krankheitsgeschehen und Behandlung, kann helfen. Verhaltenstherapeutische Ansätze dienen dazu, dass der Patient die angstauslösenden Situationen neu bewertet. Bei spezifischen Phobien (klassischerweise etwa Höhenangst, Flugangst oder Angst vor Spinnen) wird auch die Exposition eingesetzt, also die Konfrontation mit dem angstauslösenden Gegenstand in einem sicheren Rahmen, um so alternative Lösungsstrategien zu finden.
Die medikamentöse Therapie greift vor allem bei generalisierten Angststörungen und Panikattacken. Hier kommen zum Beispiel Antidepressiva und in leichteren Fällen auch pflanzliche Mittel zum Einsatz. Vorsicht ist generell bei angstlösenden Medikamenten und solchen, die körperliche Symptome reduzieren (z. B. Beta-Blocker), geboten, da hier Abhängigkeiten entstehen können.
In jedem Fall gilt aber: Angststörungen sie sind kein unabwendbares Schicksal! Höchste Zeit, sie heldenhaft zu bekämpfen.